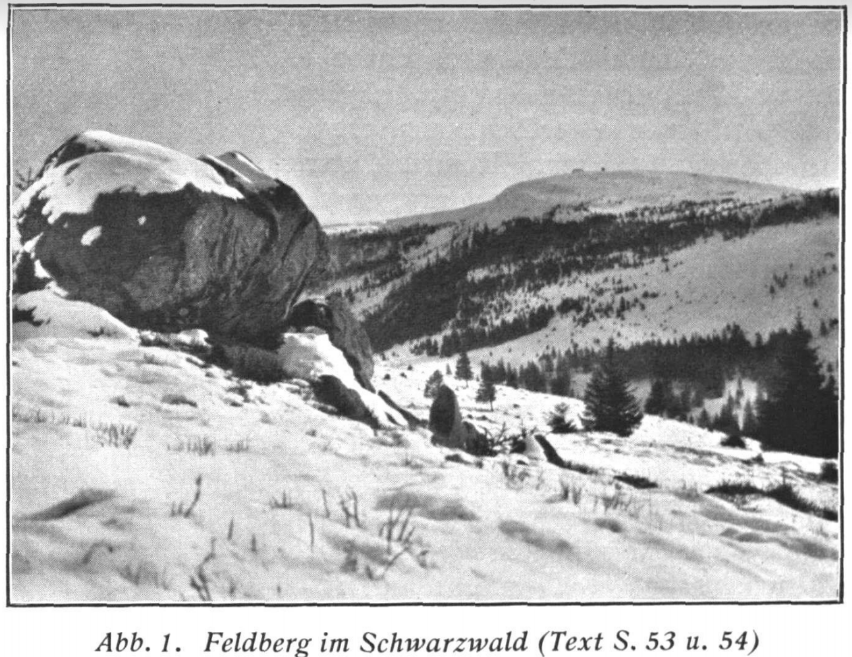Zehn Winter mit Schiern in den Bergen
von Henry Hoek
Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage, Und manche liebe Schatten steigen auf.
Goethe
Schilauf und Alpinismus hat man als säuberlich getrennte Begriffe einander gegenübergestellt, wie ja der Mensch überhaupt eine Vorliebe hat für das Machtgefühl des Einteilens. Sobald man aber über den Schilauf „an sich", über den Schilauf losgelöst von aller Relation, schreiben will, so stößt man auf eine eigenartige Schwierigkeit: diese Ablösung ist fast unmöglich. Und am allerschwersten lösbar erweist sich alsbald das Verhältnis zwischen Alpinismus und Schilauf, zwischen dem Schi und den Bergen. Die Frucht dieses Verhältnisses ist der Gegenstand des folgenden Aufsatzes, der vom Schilauf in den Bergen handelt. Es ist also wohl natürlich, daß zur Einleitung von diesen Beziehungen selbst kurz die Rede sei, das so verschiedene Beurteilung erfahren hat, je nach dem Standpunkt des Beobachters. Der Leser kann verlangen, über des Autors Standpunkt aufgeklärt zu werden.
Nicht als ob es derartiger Erörterungen nicht schon viele gäbe! Schon oft wurde z. B. die Klage laut: Der Schilauf hat der Ausführung wirklich guter winterlicher Hochtouren Abbruch getan. Und er hat nicht die Hoffnung erfüllt, daß dieser Abbruch an Güte wettgemacht würde durch eine starke Zunahme weniger schwieriger Hochtouren. Diese Klagen sind zum Teil unberechtigt, zum Teil beruhen sie auf einer mangelnden Kenntnis des Schilaufens und des winterlichen Hochgebirges. Die erwartete starke Zunahme großer Hochtouren wird und muß stets ausbleiben; Sommerzahlen werden hier nie erreicht werden, auch nicht annähernd. Ursache davon ist mitnichten, wie man oft zu hören bekommt, der „rein sportgemäße" Betrieb des Schilaufens, das, was man mit Worten „Rennen, Springen und Schwingen" meint. Daß dies nicht so ist, daß sich die große Mehrzahl der Läufer aus diesem Betriebe und Getriebe wenig macht, das beweist schon allein die riesige Zunahme subalpiner Fahrten. Es liegt die Sache eben so, daß sehr viele Bergsteiger, die den Schilauf aufnahmen, auf diesen subalpinen Türen reichlich das an körperlicher Anstrengung, an Gefahr, an geistiger Inanspruchnahme und an sportlicher Betätigung finden, was sie auf sommerlichen Hochturen mittlerer „Güte" zu leisten gewohnt sind; wirkliche Schihochtouren können nur von einer kleinen Minderheit mit Genuß gemacht werden — und auch das nur an einer kleinen Auswahl von Tagen.
Und ob nun die Qualität der winterlichen Hochtouren wirklich nachgelassen hat, wäre zuerst auch noch zu untersuchen. Sicher ist jedenfalls, daß, um einmal von den Westalpen zu reden, z. B. Finsteraarhorn, Jungfrau, Monte Rosa, Strahlhorn, Montblanc u. a. m., nie so oft im Winter bestiegen wurden, als seit dazu der Schi zu Hilfe genommen wurde, vor allem aber nie von so kleinen, oft führerlosen Partien. Das sind gewiß ganz ansehnliche Hochtouren, denen zuliebe man verschmerzen kann, daß einige wirkliche Klettereien nicht ausgeführt wurden. Aber die schmollend abseits stehenden Vertreter des reinen Alpinismus hätten auch sonst noch Grund, nicht gar zu böse zu sein, daß so mancher aus ihren Reihen den langen Hölzern verfiel.
Ich sehe davon ab, daß doch tatsächlich der Schi technisches Hilfsmittel geworden ist, ähnlich den Steigeisen und Kletterschuhen. Etwas anderes soll hier dargetan werden. Mit ziemlichem Recht kann man sagen: Schiläufen ist seinem innersten Wesen nach Bergsteigen, ist Bergsteigen, sobald man sich vom Massenübungsplatz trennt, ist Bergsteigen insofern, als ständig Probleme gestellt werden, die gelöst, ständig Fragen aufgeworfen werden, die beantwortet werden müssen. Es kommt natürlich sehr darauf an, was man unter „Bergsteigen" versteht. Zählt man aber die Erkletterung der Sandsteintürme der Sächsischen Schweiz dazu, so ist nicht einzusehen, weshalb eine im Schneesturm erzwungene Wanderung über den Riesengebirgskamm nicht dazu gehören, weshalb man die Abfahrt über einen schweren, gefährlichen, zerrissenen Schwarzwaldhang nicht dazu rechnen sollte.